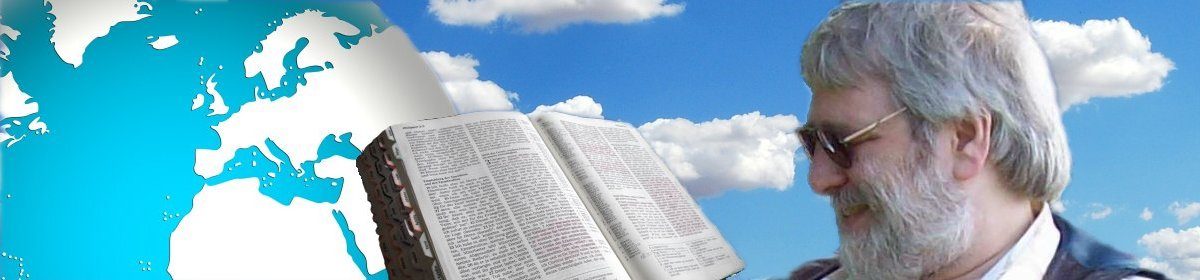Auf dem Blog stabillabil von Franz Naarn habe ich den folgenden Beitrag gefunden. Dieser beschreibt den Konflikt eines an Depression Erkrankten mit dem Glauben und Gott so gut, dass ich ihn hier vorstellen möchte.
– – – – – – – – – –
Franz Naarn: Glaube und Depression
Vor meiner derzeitigen depressiven Episode betete ich regelmäßig und innig: Die Verlängerung des irdischen Schauspiels in die Unendlichkeit hinein glückte mir fast spielerisch. Die Beziehung zu Gott war lebendig. Der Glaube trug mich über dem Abgrund, der das Leben ist. Und ich war – täglich neu – fähig, vertrauensvoll in ihn hineinzuspringen (vgl. Søren Kierkegaard).
Mit dem Ausbruch der Depression wurde das ganz anders. Die Krankheit kappte gnadenlos meine ohnehin brüchigen Stege zur Mitwelt; ich wurde eine Insel und es war mir nicht mehr möglich, mich zum Zwecke der Verbindungsaufnahme zu verlassen. Ich konnte mich nur mehr rastlos auf mir – und am äußersten Rande um mich selbst kreisend – bewegen. Die Mehrdimensionalität des Lebens reduzierte sich drastisch, alles wurde seltsam flach und zeitlos. Das einsame Eiland, das ich war, glich einer grauen Fläche, ohne Konturen, ohne Relief. Mich jetzt auf die Dimension unendlich einzulassen, auf einen Gott zu hoffen, ihm gar so zu vertrauen, dass das Leben dadurch spürbar Auftrieb bekam, schien mir völlig unmöglich. Es war einfach keine wählbare Option. Intellektuell dachte ich zwar manchmal daran und verspürte dann eine leichte Wehmut, aber der Verlust meines Glaubens schmerzte mich in meiner Depression niemals einschneidend. Die Faktizität meiner Ichbezogenheit war so überwältigend, dass ich das Göttliche bald nicht einmal mehr vermisste. Es gab jenseits meines stummen Elends einfach keine Welt … Fazit: Die Depression bezweifelt auf radikale Weise alles außerhalb ihrer selbst. Sie ist das Asoziale schlechthin. Glaube hingegen ist vertrauensvolle Hingabe, ein Sich-selbst-Übersteigen zum geliebten anderen hin. Der schwer Depressive ist der wahren Liebe unfähig.
Und jetzt, heute? Ich kann inzwischen manchmal Brücken zu Gott und zur Welt bauen. Anderntags gibt es dann ein heftiges seelisches Nachbeben, und der daraus resultierende Tsunami spült die fragilen Bauwerke einfach weg. Es bleibt mir wieder nur die Möglichkeit, auf den kalten, grauen Ozean hinauszustarren. Und könnte ich mich durchringen, SOS zu senden (denn eine Funkstation habe ich zur Verfügung), wüsste ich nicht, ob ich die herannahende Rettung begrüßen und annehmen würde. Es verhält sich in meiner Depression nämlich so: Das Bedürfnis nach Gott ist um einen Hauch geringer, als mir die Idee von ihm lächerlich vorkommt; und die Sehnsucht nach den Menschen quält mich um ein kleines Stückchen weniger, als die Angst vor ihnen. Und diese feinen Differenzen sind das Fürchterlichste, das einem widerfahren kann.
Man ist eine Kerze, die sich vor dem Feuer fürchtet.